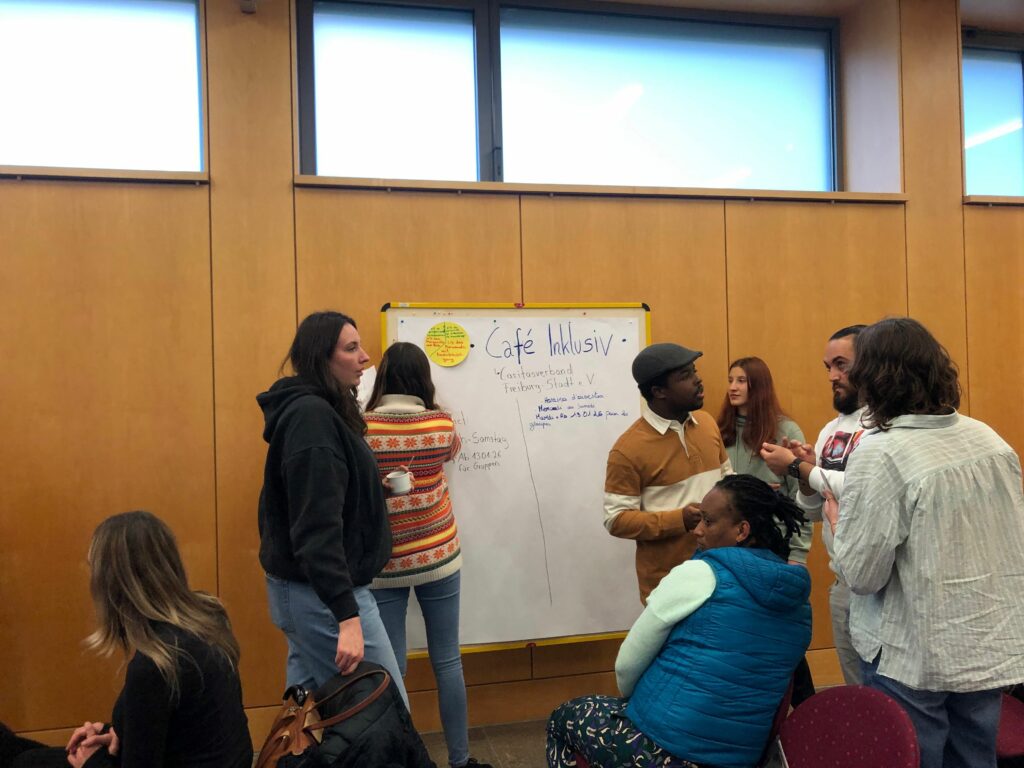„In Deutschland fehlen laut IW-Kurzbericht 27/2024 aktuell 573.000 qualifizierte Arbeitskräfte“ (Burstedde & Kolev- Schaefer 2024). Dies hat enorme Auswirkungen auf das Gesundheits- und Sozialsystem. Jedoch macht der Fachkräftemangel nicht an Ländergrenzen Halt. Auch die Schweiz und Frankreich sind betroffen. Doch wie lässt sich die Attraktivität sozialer Berufe stärken? Wie lassen sich soziale Studiengänge diesbezüglich weiterentwickeln? Wie kann allgemein mit dem Fachkräftemangel im sozialen Bereich umgegangen werden?
Um über diese Themen zu beraten, kam am 23.06.2025 die Arbeitsgruppe Arbeitgebende an der ESEIS (École Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale) in Straßburg zusammen. Etwa 20 Personen aus der Oberrheinregion waren beim Treffen dabei. Die Arbeitsgruppe ist Teil des Projekts CELIS, das sich die Schaffung des Europäischen Campus Soziale Arbeit zum Ziel gesetzt hat. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus verschiedenen Arbeitgebenden aus der trinationalen Metropolregion des Oberrheins zusammen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende grenzüberschreitende Problematiken zu analysieren und daraus spezifische Bedarfe an grenzüberschreitenden Qualifikationen abzuleiten.
Zu Beginn des Arbeitstreffens wurde eine länderspezifische Bestandsaufnahme vorgenommen und Impulse gesetzt.
✅Prof.in Dr. Stephanie Bohlen, Rektorin der Katholischen Hochschule (KH) Freiburg, hob hervor, dass soziale Berufe für unsere Gesellschaften unverzichtbar sind und warnte vor einer Katastrophe in Bezug auf die (soziale) Versorgung der Menschen, wenn das nicht erkannt wird.
✅Auch Chantal Mazaeff, Direktorin der École de Praxis Sociale (Praxis) Mulhouse, betonte die Notwendigkeit, das soziale System zu reformieren und neu zu denken, auch in Bezug auf Wertschätzung, Arbeitsbedingungen und Vergütung.
✅Marco Wenger, Vertreter der Arbeitsgruppe Fachkräftesituation im Sozialbereich in der Schweiz der Hochschule für Soziale Arbeit (HSA) der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), schilderte eine etwas weniger dramatische Situation, da das Land von Arbeitsmigration profitiert, gerade im Dreiländereck. Aber auch in der Schweiz muss angesichts eines steigenden Bedarfs an Fachkräften gegengesteuert werden. Die Schweizer Kollegen betonten die hohe Arbeitsbelastung, die teilweise keine Vollzeitbeschäftigung zulässt.
✅Im Anschluss an die Vorträge tauschten die Vertreter*innen der Arbeitgebenden sich zu ihren Erfahrungen aus. Die größten Länderunterschiede wurden bei den Gehältern, Ausbildungen und Abschlüssen festgestellt ebenso beim Thema Quereinstieg. Ähnlichkeiten wurden bei der fehlenden Wertschätzung und hohen Arbeitsbelastung für Personen in sozialen Berufen gesehen. Auch die Probleme der Überalterung der Gesellschaften und des daraus resultierenden Fachkräftemangels sowie der häufige Wechsel der Arbeitnehmenden der Arbeitsstelle sowie teilweise des kompletten Arbeitsfelds betreffen alle drei Länder.
✅Am Nachmittag fanden sich verschiedene Kleingruppen zusammen, welche Lösungsansätze hinsichtlich der jeweiligen Themenschwerpunkte erarbeiteten. Diese Ansätze wurden im Plenum präsentiert, diskutiert und reflektiert. Weiterhin wurde über alternative Lösungsmöglichkeiten und Spezifika innerhalb der jeweiligen Länder nachgedacht. Gerade die länderübergreifenden Gemeinsamkeiten zur Erarbeitung gemeinsamer Problemlösungen genutzt werden. Dies lässt optimistisch auf solch eine Form der internationalen Zusammenarbeit von Arbeitgebenden blicken.
➡️CELIS greift die Ergebnisse der Treffen der Arbeitsgruppe auf, um Lösungen auf drei verschiedenen Ebenen anzustoßen: für Studierende, Arbeitgebende und Fachkräfte.
📅Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe findet am 13.11.2025 an der KH Freiburg statt zum Thema „Erstarken der Extreme – Auswirkungen auf den sozialen Bereich“.
Burstedde, A. & Kolev-Schaefer, G. (2024). Die Kosten des Fachkräftemangels.
IW-Kurzbericht Nr. 27/2024. Online unter: https://www.iwkoeln.de/studien/alexander-burstedde-galina-kolev-schaefer-die-kosten-des-fachkraeftemangels.html